Es gab einmal ein Leben, in dem befand ich mich mehrere Wochen des Jahres als Musiker auf Tour. Eine solche Existenz besteht bekanntlich und maßgeblich aus zwei Dingen: zwischen den Städten im Bus sitzen (Hinfahrt) und zwischen den Städten im Bus sitzen (Rückfahrt). Was einem einerseits die Möglichkeit gibt, den vornächtlichen Kater angemessen zu verarbeiten, andererseits aber auch die Gelegenheit verschafft, entlang der A7 quer durch Deutschland eine gewisse analytische Autobahnperspektive auf Deutschlands Städte zu entwickeln. Und, glauben Sie mir: Am Fenster klebend, die Augen vorbeiziehenden Silhouetten nachjagend, fragte ich mich seinerzeit nicht selten: Warum zur Hölle wohnen hier Menschen? Was veranlasst sie, hierzubleiben, zu heiraten, Kinder zu bekommen, diese auf die Schule zu schicken, zu ermuntern, ebenfalls hier ihr Leben zu verbringen? Auch der Blick in die Fußgängerzonen – insbesondere so genannter „Mittelstädte“, zu denen auch Augsburg zählt – machte die Sache oftmals nicht besser. Bei Inaugenscheinnahme der immer gleichen Globalisierungsfilialen von Starbucks bis H&M blieb die Frage dieselbe: Ist das deren Ernst? Hier leben, arbeiten und wohnen Menschen? Man reiste erstaunt weiter, am Schluss nach Hause, in dieselbe gleichförmige Welt.
Heimat ist keine Begrifflichkeit von eindimensionaler Bedeutung. Heimat, das ist ein schwieriges Thema, auch in der x-ten Generation nach dem Zweiten Weltkrieg ohnehin und wohl noch eine ganze Weile. Heimat, das ist eine Idee, die gefährlich ist. Vor allem, weil sie das verspricht, was jeder sucht: einen beschützten Ort im Lauf des rauen Lebens. Heimat, das ist ein Identifikationspotenzial, nicht mehr und nicht weniger. Ob es ausgeschöpft wird, folgt einer schwer nachvollziehbaren Arithmetik aus unzähligen Parametern.
Aus der schwäbischen Kleinstadt Günzburg stammend, stolperte ich das erste Mal über die Frage, was denn Heimat für mich sei, als eine Vielzahl internationaler Journalisten in den 80er-Jahren in dem beschaulichen Städtchen auftauchten, um nach dem Verbleib des hier geborenen KZ-Arztes Josef Mengele zu fahnden. Hier hatte ich meine Kindheit verbracht, die Vertrautheit der Straßen und Gässchen ließ mich beschützt fühlen, sicher und daheim. Aber konnte, nein, durfte dies wirklich Heimat sein, wenn innerhalb dieser Mauern ein derartig schlimmer Mensch dieselbe Geborgenheit fühlte? Ich beschloss: nein. Ein Prozess innerer Distanzierung setzte sich in Gang, von dem sich mein „Günzburg-Gefühl“,wenn nicht sogar mein „Heimatgefühl“, bis heute nicht erholt hat.
Einige Jahre lebte ich in Berlin. Als ich neulich dorthin zurückkehrte, Straßen und Kiez von damals in Augenschein nahm, überkam mich ein sentimentales Gefühl: Hier hatte ich mich als junger Erwachsener zu Hause gefühlt wie nirgends zuvor. In der Fremde war ich auf etwas gestoßen, das ich zuvor abgestoßen hatte: ein Heimatgefühl, ein Gefühl von: Hier will ich sein! Nie wieder weg! Kommen, um zu bleiben! Nun, beim erneuten Besuch, trat an diese Stelle eine Art von pragmatischem Verstehen: Nicht Berlin, sondern ich selbst hatte mir damals dieses Heimatgefühl verschafft, in einer kompletten Anverwandlung der Idee, Wohnen und Arbeit, Feiern und Kultur, Kreativität und soziales Sein im Einklang zu erleben – etwas, das im Berlin der Nuller-Jahre so einfach schien wie an keinem anderen Ort. Kaum überraschend hatte sich dieses Empfinden irgendwann von selbst und vor allem mich zur Gänze erschöpft. Es war schlicht nicht mehr greifbar, nicht rückholbar, beim neuerlichen Flanieren durch den alten Kiez. Ist Heimat also eine Täuschung der Sinne? Ein temporäres Phänomen? Ich fühlte nicht mehr dasselbe. Ich war erstaunt.




 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV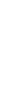
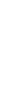
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 Architektur
Architektur 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 01/2024
01/2024 02/2024
02/2024 Architektur
Architektur 03/2024
03/2024 04/2024
04/2024 01/2025
01/2025 02/2025
02/2025