Der gebürtige Lindauer Maler Dieter Krieg (1937-2005) hat nie viel Aufhebens um sich gemacht. Er gehörte zu den eher leisen, stillen Künstlern und war doch einer der bedeutendsten deutschen Maler in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das Alltägliche mit dem Existentiellen, mit der Literatur und der Sprache zu verknüpfen und durch die Kraft der Farben leuchten zu lassen, machen das Faszinierende seiner Großformate aus. Maya Heckelmann, Kuratorin der Krieg-Ausstellung im Künstlerhaus Marktoberdorf, über einen Künstler, der das Wesentliche suchte.
Dieter Krieg ist ein Meister des großen Formats. Seine Themen sind dagegen auf der Bedeutungsebene alles andere als „groß“: Spiegeleier, Bierdeckel, Putzeimer, Klotüren. Banale Alltagsgegenstände werden in monumentalem Großformat auf die Leinwand geworfen. Die profane Dingwelt unbeachteter, wertloser Gebrauchsgegenstände ermöglicht ihm als Maler die größtmögliche Freiheit – die Ikonographie wird nebensächlich, der malerische Impetus zum eigentlichen Bildinhalt. Gleich einem Vulkanausbruch schieben sich die Farbmassen wie flüssige Lava über den Bildträger. Die Spuren des Malvorgangs – Schlieren, Pinselstriche, Spachtel-, Hand- und Fußspuren – sind überall auf der Bildfläche sichtbar. Die Arbeiten entstehen auf dem Boden. Der Malprozess ist Dieter Krieg enorm wichtig und soll auch für den Betrachter sichtbar sein, so drücken sich Keilrahmen und Holzverstrebungen nicht selten auf der Vorderseite des Bildes durch. Dieter Krieg will keinen illusionistischen Bildraum erschaffen. Distanzlos zwingen einen seine Gemälde zur direkten Konfrontation.
Die dargestellten Gegenstände sind keineswegs willkürlich gewählt, sie gehören einem Bildvokabular an, das Krieg über Jahrzehnte hinweg benutzt und fortentwickelt hat. Hinter vordergründig Alltäglichem verstecken sich existenzielle Aussagen.
Die Möwe – ein fliegender Vogel mag als Freiheitssymbol gedeutet werden – steht dem Wort „Sucht“, der Abhängigkeit und Unfreiheit gegenüber. Stets ist da das Kraftfeld der Literatur und der Sprache, dessen sich Krieg in seiner Malerei bedient. So verweist etwa die monumentale Bank, die einen an der zentralen Wand im Künstlerhaus begrüßt, mit dem über ihrer Sitzfläche schwebenden Wort „Wartn“ auf Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf Godot“, wenn man die Vorzeichnung zu dieser Arbeit kennt, die mit „für Watt“ beschriftet ist und ebenfalls als eine Hommage an Beckett bzw. seine Novelle „Watt“ anzusehen ist.


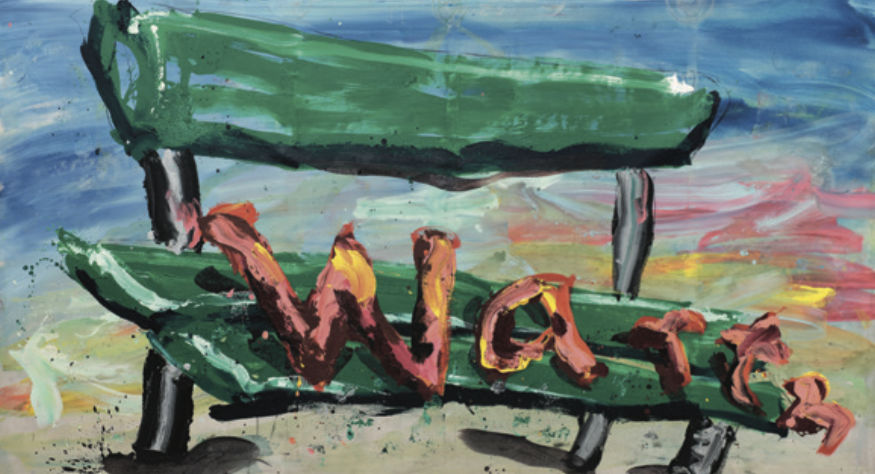

 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV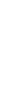
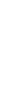
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 Architektur
Architektur 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 01/2024
01/2024 02/2024
02/2024 Architektur
Architektur 03/2024
03/2024 04/2024
04/2024 01/2025
01/2025 02/2025
02/2025 Architektur
Architektur 03/2025
03/2025