Die einstigen Träger von Bildung und europäischer Idee sterben aus.
Auch in Europa bekommen Nationalismus und Populismus seit Jahren wieder Aufwind. Und in der Bildung schneidet Deutschland ein ums andere Mal beim PISA-Test nicht gut ab. Es ist vermutlich kein Zufall, dass diese Entwicklungen mit dem Niedergang der Klosterkultur hierzulande zusammenfallen. Denn das Christentum war für Europa nicht nur identitätsstiftend, Nonnen und Mönche brachten in Klosterschulen einst auch Bildung unter die Leute.
Im Anfang waren die Mönche. So könnte man eine Geschichte jenes Landstrichs beginnen, den wir unter dem Kunstnamen Bayerisch-Schwaben kennen. Als sich aus den dunklen Jahrhunderten nach dem Zusammenbruch der Römerherrschaft lang- sam wieder historische Überlieferung hervorwagt, beleuchten diese Lichtkegel, noch flackernd zwar und die Szenerie nicht zur Gänze erhellend, ein Land, das lange als römische Provinz Rätien verwaltet wurde und nun von Mönchen neu kultiviert wird. Bereits vom Ende des fünften Jahrhunderts gibt es Nachrichten von einem Gottsucher namens Severin, der in Passau eine kleine Cella errichtet. Um das Jahr 565 erhalten wir Kunde von der Verehrung der Märtyrerin Afra in Augsburg, einhergehend mit der Vermutung, dass die ersten Bischöfe in der Lechstadt zugleich als Äbte einer Brüdergemeinschaft vorstanden, die sich um das Afra-Grab gesammelt hatte. Kein geringeres Werk als „Der Gang der Weltgeschichte“ des Universalhistorikers Arnold Toynbee bescheinigt der Kirche als einer „Überlebenden“ aus dem sterbenden römischen Gesellschaftskörper, „der Schoß“ gewesen zu sein, aus dem der neue abendländische Körper geboren wurde.
Als die Quellen reicher zu fließen beginnen, im 8. Jahrhundert, wird allmählich ein Gesamtbild sichtbar von dieser Geburt auf dem Gebiet des absterbenden Rätien, mit Klostergründungen durch den heiligen Magnus in Füssen, den Augsburger Bischof Wikpert in Fultenbach (heutiger Landkreis Dillingen), in Kempten und Ottobeuren, in Thierhaupten durch Bayern-Herzog Tassilo, dieser auch Gründer der Klöster Wessobrunn, Polling und Benediktbeuren, die – „politisch“ in Oberbayern verortet – zum Bistum Augsburg gehören. Es zeichnet sich jene Klosterlandschaft ab, die jahrhundertelang mit ihrem immerwährenden Gebet das Land durchwirkt, große Teile der Seelsorge trägt und auch als weltliche Herrschaft fun- giert; die das Land kultiviert, angefangen von Rodungen und Urbarmachungen wie im Falle Fultenbachs ganz wörtlich, den Boden bestellt, indem jedes größere Kloster eine Landwirtschaft betreibt, aber auch im übertragenen Sinne Kulturbringer auf dem Lande ist, als Vermittler von Bildung und Wissenschaft.
MÖNCHE WAREN HAUPTTRÄGER VON GESELLSCHAFT UND KULTUR
So erweist sich in den Worten des Münchner Historikers Friedrich Prinz das Mönchtum als „geistiger Hauptträger von Gesellschaft und Kultur“, die Kirche als „Lenkerin der großen Umwandlung, aus der Europa hervorging“, jenes Abendland, das auf drei Hügeln – Golgatha, Athen und Rom – erbaut ist, wie es Bundespräsident Theodor Heuss formulierte. Dass die Kenntnis von der Antike ihren Zusammenbruch überlebte, auch das gehört zur monastischen Kulturleistung. Wenn „Europas kulturelle Identität“, so der Latinist Manfred Fuhrmann, sich am Vorbild der Antike entfaltete, dann war dies nur möglich, weil „das Erbe, in Bücher gleichsam verpackt“, von Mönchen in Klosterbibliotheken gehütet wurde.



 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV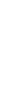
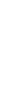
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 Architektur
Architektur 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 01/2024
01/2024 02/2024
02/2024 Architektur
Architektur 03/2024
03/2024 04/2024
04/2024 01/2025
01/2025 02/2025
02/2025 Architektur
Architektur 03/2025
03/2025 04/2025
04/2025