Winter, kurze Tage, lange Abende, Lesezeit: Wer in Augsburg und um Augsburg herum Regionales erkunden will, für den haben wir Ideen zusammengetragen.
NÖRDLINGER INSPIRATIONEN – WILHELM HAUFFS VOLKSMÄRCHEN
Im Weltbild-Verlag erschien vor nicht allzu langer Zeit eine mehrere Regalbretter füllende „Bibliothek der Weltliteratur“. Einer der „Deutschen Klassiker“: „Wilhelm Hauffs Sämtliche Werke in zwei Bänden“. Darin Märchen, die Hauffs Ruhm bis in unsere Tage getragen haben: „Die Geschichte vom kleinen Muck“ wurde schnell zum Volksgut, obschon sie in orientalischem Gewand daherspaziert. Vielfach übersetzt, gehören auch „Kalif Storch“ und „Zwerg Nase“ zur Weltliteratur. Und die Moritat vom kalten Herzen, an dessen Stelle ein Stein sitzt, lässt keinen Leser unberührt. Wilhelm Hauff (1802-1827), Sohn eines protestantischen Regierungs-Sekretarius an der Stuttgarter Residenz, zählt zur Schwäbischen Dichterschule – welche sich nicht östlich von Iller und Alb gegründet hat, sondern in Tübingen, im württembergischen Kernland. Doch Hauff, studierter Theologe, der nicht Pfarrer werden will, sein Geld zunächst als Hauslehrer verdient, später als Cotta’scher Redakteur, kehrt oft bei einer Tante in Nördlingen ein. Dort, im Ries, lernt er seine Cousine Luise lieben. 1824 wird die Verlobung annonciert, bald darauf, vor 200 Jahren also, tritt Hauff mit seinem ersten Werk als Schriftsteller in die Öffentlichkeit und nicht lange danach mit dem „Märchen-Almanach auf das Jahr 1926 für Söhne und Töchter gebildeter Stände“.
VOLKSKUNDE, GEBOREN AM LECH – VATER: WILHELM HEINRICH RIEHL
Als „glücklichste Zeit“ seines Lebens bezeichnet der Rheinländer Wilhelm Heinrich Riehl (1823-1897) – obschon später in München zum Professor und Königsberater aufgestiegen – die Jahre in Augsburg, wo er von 1851 bis 1854 als Redakteur der Allgemeinen Zeitung tätig ist. Er sollte der „schönsten Stadt in Deutschland“ (Robert Peel) in seinen „Culturstudien aus drei Jahrhunderten“ (1859) ein prächtiges Denkmal setzen – und sich selbst einen weithin bekannten Namen machen. Als es Riehl an den Lech zieht, sind die Tage von Glanz und Gloria bereits gezählt. Der Magnet der Residenzstadt München lockt an, was Rang und Namen hat, und Augsburg gerät mehr und mehr in den Schatten dieser neuen Metropole – ohne die Vitalität, Geist zu erzeugen und bar der alten Strahlkraft, Geist an sich zu binden. Mit einer Ausnahme, die ihr glücklich zufällt: Das Stuttgarter Verlagshaus Cotta, Heimat Goethes und Schillers, verlegt 1807, um der württembergischen Zensur zu entgehen, die Redaktion ihrer „Allgemeinen Zeitung“, eine Perle europäischen Geisteslebens, nach Augsburg. Seither ist die Schwabenkapitale der Ort, an dem Heinrich Heine seine Korrespondentenberichte aus Paris einrücken lässt und überhaupt eine illustre Schar an Geistesgrößen veröffentlicht. Im 19. Jahrhundert verdankt die Stadt dieser Zeitung ihre Anziehungskraft auf kluge Köpfe. Der Glanz von Cottas Intelligenzblatt leuchtet weiter in Büchern wie Heines „Französische Zustände“ (1833), in den Russland-Korrespondenzen des Deutschbalten Aurelio Buddeus und in Friedrich Lists Werk „Das nationale System der politischen Ökonomie“ (1841), dessen Autor sich beim Herausgeber dafür bedankt, dass er viele Gedanken „in seinem berühmten Blatte“ erproben durfte. Ähnliches gilt für Riehls „Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Social-Politik“ – der berühmte Band „Land und Leute“, Gründungsmanifest der Volkskunde, ist ganz und gar ein Augsburger Kind (und als einziges der Riehl’schen Werke heute noch im Handel erhältlich). Riehl schreibt – so sein Selbstanspruch – als „Wanderer und Journalist“.




 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV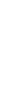
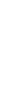
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 Architektur
Architektur 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 01/2024
01/2024 02/2024
02/2024 Architektur
Architektur 03/2024
03/2024 04/2024
04/2024 01/2025
01/2025 02/2025
02/2025