Professorin Elisabeth André von der Universität Augsburg erklärt im Gespräch mit der edition:schwaben, was unter dem Begriff der Künstlichen Intelligenz zu verstehen ist, wo ihr Einsatz sinnvoll ist und warum wir keine Angst vor der KI haben sollten.
Frau Professor André, Sie sind Expertin für Künstliche Intelligenz. Wie oft begegnet Ihnen KI im Alltag?
Sehr oft. Das beginnt in der Kommunikation. Ich erhalte zum Beispiel E-Mails von Studierenden, in denen der einleitende Satz steht: ‚Ich hoffe, diese Nachricht erreicht Sie bei bester Gesundheit‘. Da liegt der Verdacht nahe, dass hier jemand auf einen KI-Text, etwa von ChatGPT, zurückgegriffen hat.
Halten Sie das für legitim?
Natürlich. Nur sollten die Nutzerinnen und Nutzer eben nicht blind dem Tool vertrauen. Der Text im genannten Beispiel klingt etwas unpassend und ist fast schon witzig. Das zeigt, dass der Mensch in vielen Fällen mit all seiner Erfahrung und Expertise eingreifen und den KI-Vorschlag verändern sollte.
Also ist der Mensch der KI doch überlegen?
Das kann man so nicht sagen. Es hängt vom Einsatzgebiet ab. Und es gibt Bereiche, in denen der Mensch der Künstlichen Intelligenz nicht mehr Paroli bieten kann – beispielsweise im Schach. Dazu ist aber zu sagen, dass das Schachspiel ein abgegrenzter Bereich ist, innerhalb dessen die Maschine die erforderlichen Daten viel schneller verarbeitet als ein Mensch. Dafür weisen wir Menschen uns insgesamt durch eine größere Flexibilität aus und können besser mit unvorhergesehenen Situationen umgehen.
Durch die KI braucht es nicht mehr zwingend einen Wenn-Dann-Mechanismus?
Genau. Die KI kann aus Beispieldaten lernen, Muster zu erkennen. Und wenn man der KI dann neue Daten präsentiert, ist sie in der Lage, das Wissen, das sie anhand eines Trainingsdatensatzes gelernt hat, anzuwenden. Hierbei kommen meist neuronale Netze zum Einsatz, die an die Funktionsweise des menschlichen Nervensystems angelehnt sind. Dadurch können die Maschinen lernen, ohne dass der Mensch alles bis in sämtliche Einzelheiten vorprogrammieren muss.
Wie würden Sie denn die künstliche von der menschlichen Intelligenz abgrenzen?
Während die menschliche Intelligenz umfassend ist, bildet die Künstliche Intelligenz immer nur Teilbereiche der Wirklichkeit ab. Daran ändert auch die vermeintliche Vielseitigkeit von neueren Entwicklungen wie ChatGPT nichts. Wenn Situationen komplex sind, ist der Mensch im Vorteil – etwa bei Verhandlungen, weil hier psychologische Aspekte eine große Rolle spielen. Zudem ist die Energiebilanz beim menschlichen Gehirn deutlich positiver, da es viel energieeffizienter als die Künstliche Intelligenz arbeitet.
Wo sehen Sie großes Potenzial in der weiteren KI-Entwicklung?
Viele Bereiche können davon profitieren. Im Gesundheitsbereich sind die Einsatzmöglichkeiten enorm. Eine Genomsequenzierung, die im Jahr 2000 noch Millionen von Euro gekostet hat, ist heute für weniger als 1.000 Euro zu bekommen. Auch das produzierende Gewerbe profitiert, indem durch die Verwendung von KI der Einsatz von Maschinen besser geplant werden kann. Das ermöglichen Sensoren, die an Industriemaschinen angebracht werden und etwa Vorhersagen zu notwendigen Wartungsarbeiten erlauben. Durch die Auswertung, die KI-Tools übernehmen, können Unregelmäßigkeiten an der Maschine früher festgestellt und damit größere Schäden vermieden werden. Der Unterschied zu früheren Automatisierungsdebatten ist jedoch, dass man sich nun darauf einstellen muss, dass die KI auch Tätigkeiten von Personen mit einem eher höheren Lohnniveau im Bereich der Wissensverarbeitung übernimmt.




 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV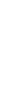
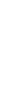
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 Architektur
Architektur 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 01/2024
01/2024 02/2024
02/2024 Architektur
Architektur 03/2024
03/2024 04/2024
04/2024 01/2025
01/2025 02/2025
02/2025