Wer am Frühstückstisch die Nachrichten von den jüngsten Gräueltaten in den syrischen Städten Aleppo und Homs liest, am Abend die Fernsehbilder von den verzweifelten Menschen inmitten ihrer vom Bür- gerkrieg zerstörten Straßenzüge sieht, wird sich dem Schrecken und dem Leid der Zivilbevölkerung nicht ganz entziehen können. Einzelne packt die Wut über das sinnlose Gemetzel der Macht wegen. Andere wiederum diskutieren über die Hilflosigkeit der Weltgemeinschaft. Ein paar Weichherzige kommen einem Spendenaufruf nach. Die meisten Menschen verhalten sich jedoch indifferent und zu guter Letzt passiv. Nur ganz wenige fühlen sich von den Berichten so tief berührt, dass sie sich selbstlos in ein Katastrophen- oder Kriegsgebiet aufmachen, um dort medizinische oder technische zu Hilfe leisten.
Was treibt nun diese Menschen an, die als Krankenschwestern, Ärzte oder Ingenieure für Hilfsorganisationen wie „Cap Anamur“ oder „Ärzte ohne Grenzen“ die Sicherheit und die Annehmlichkeiten der Heimat für einige Monate mit einem Feldbett im Bombenhagel vertauschen? Warum stehen manche Mediziner in ihrem Urlaub lieber am Operationstisch in fernen Ländern als an einer Strandbar? Autor Jürgen Schmid hat sich mit einigen der selbstlosen Helfer aus Bayerisch-Schwaben getroffen.
Wer einen unbezahlten Job bei „Cap Anamur – Deutsche Not-Ärzte e. V.“ ergattern will, muss erst einmal die Grenzen der eigenen Geduld ausloten. Denn offenbar irrt, wer glaubt, derartige Hilfsorganisationen würden eine erfahrene Krankenschwester wie Stephanie Günther aus Zusmarshausen mit Handkuss aufnehmen, wenn sie unbedingt in einem Krisengebiet wie dem irakischen Kurdistan arbeiten möchte. Ihr Arbeitgeber, ein großes Krankenhaus in der Region, hatte im Herbst 1990 ihren Antrag auf ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub abgelehnt. Von solch bürokratischen Querköpfen wollte sich die selbstbewusste Frau aber nicht abhalten lassen und hat sogar die Kündigung des Arbeitsverhältnisses erwogen. Dann verfiel sie auf die Idee, zwei Jahresurlaube zusammenzulegen, was wiederum nicht ganz den Vorstellungen ihres Ehemannes entsprach. Nachdem dieses Thema privatissime geklärt wurde, genügte ihr Engagement wiederum den Richtlinien von Cap Anamur nicht: Die Verantwortlichen bestanden auf einem Einsatz über volle sechs Monate, wie es die Statuten der 1982 gegründeten Hilfsorganisation vorschreiben. Spätestens an diesem Punkt hätte wahrscheinlich jeder andere Gutwillige seiner Enttäuschung über die immer neuen Hürden, die sich ihm in den Weg stellten, freien Lauf gelassen – und das Angebot einer Mitarbeit zurückgezogen. Nicht so Stephanie Günther: „Ich bin trotzdem gegangen“, erzählt sie in einem freundlichen Ton, der allerdings kaum Widerspruch in der Sache gestatten dürfte, wenn sie sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Da es offensichtlich auf offiziellem Weg nicht möglich war, für „Cap Anamur“ im irakischen Kurdengebiet zu arbeiten, kam die Krankenschwester auf die Idee, auf eigene Faust anzureisen und dann ihren Dienste einfach vor Ort anzubieten: „Kurzum, ich habe meinen Flug selber bezahlt.“




 AUSGABENARCHIV
AUSGABENARCHIV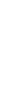
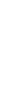
 02/2006
02/2006 03/2006
03/2006 04/2006
04/2006 01/2007
01/2007 SA 01/07
SA 01/07 02/2007
02/2007 03/2007
03/2007 SA 02/07
SA 02/07 04/2007
04/2007 01/2008
01/2008 SA 01/08
SA 01/08 02/2008
02/2008 03/2008
03/2008 SA 02/08
SA 02/08 04/2008
04/2008 01/2009
01/2009 02/2009
02/2009 03/2009
03/2009 SA 01/09
SA 01/09 04/2009
04/2009 01/2010
01/2010 SA 01/10
SA 01/10 02/2010
02/2010 03/2010
03/2010 SA 02/10
SA 02/10 04/2010
04/2010 SA 01/11
SA 01/11 02/2011
02/2011 03/2011
03/2011 SA 02/11
SA 02/11 04/2011
04/2011 01/2012
01/2012 SA 01/12
SA 01/12 02/2012
02/2012 03/2012
03/2012 SA 02/12
SA 02/12 04/2012
04/2012 01/2013
01/2013 SA 01/13
SA 01/13 02/2013
02/2013 03/2013
03/2013 04/2013
04/2013 01/2014
01/2014 SA 01/2014
SA 01/2014 02/2014
02/2014 03/2014
03/2014 04/2014
04/2014 01/2015
01/2015 SA 01/2015
SA 01/2015 02/2015
02/2015 03/2015
03/2015 04/2015
04/2015 01/2016
01/2016 SA 01/2016
SA 01/2016 02 / 2016
02 / 2016 03 / 2016
03 / 2016 04/2016
04/2016 01/2017
01/2017 SA 02/2017
SA 02/2017 02/2017
02/2017 03 / 2017
03 / 2017 04/2017
04/2017 01/2018
01/2018 SA 02/2018
SA 02/2018 02/2018
02/2018 03/2018
03/2018 04/2018
04/2018 01/2019
01/2019 02/2019
02/2019 03/2019
03/2019 01/2020
01/2020 02/2020
02/2020 03/2020
03/2020 04/2022
04/2022 01/2023
01/2023 02/2023
02/2023 03/2023
03/2023 04/2023
04/2023 05/2023
05/2023 01/2024
01/2024